Über den antifaschistischen Grundkonsens nach dem Zweiten Weltkrieg und das Bewahren des Erbes der Widerstandskämpfer. Ein Gespräch mit Alice Czyborra und Silvia Gingold
Ihre Eltern, die jüdischen, kommunistischen Widerstandskämpfer Ettie und Peter Gingold, bekämpften den Hitlerfaschismus bis zum Schluss. Sie überlebten die Herrschaft der Nazis. Welchen Einfluss hatten die Erfahrungen des – kommunistischen – Widerstandes auf die Entwicklung in der BRD?
Silvia Gingold: Unsere Eltern wurden immer wieder gefragt, warum sie nach zwölf Jahren der Emigration in Frankreich, wo sie im Widerstand gegen Hitler täglich ihr Leben riskierten, Gefängnis und Folter durchleiden mussten, Angehörige in den Gaskammern in Auschwitz verloren, warum sie in das Land der Täter zurückkehrten. Sie taten dies in der Hoffnung und aus der tiefen Überzeugung, ein neues, ein demokratisches, antifaschistisches Deutschland aufbauen zu helfen. Denn wer, wenn nicht die überlebenden Antifaschisten, konnte dazu beitragen?
In den Worten unseres Vaters: »Wir glaubten, in einer Gesellschaft leben zu können, in der man offen seine Gesinnung, auch die sozialistische und kommunistische, zeigen und auch für diese eintreten kann, ohne diskriminiert, benachteiligt und verfolgt zu werden.« Die Überlebenden des barbarischen NS-Regimes schworen: »Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!«. Das war der Grundkonsens nach dem Kriegsende, der auch das Grundgesetz vor 76 Jahren prägte. Niemals mehr sollte von deutschem Boden Krieg ausgehen.

Alicia Czyborra bei einer Aktion zum Putzen von Stolpersteinen in Gedenken an Naziopfer in Steele (12.11.2022)
Silvia Gingold spricht anlässlich einer Stolpersteinverlegung für acht Mitglieder der Familia Gingold in Frankfurt am Main (4.9.2021)Alice Czyborra, 1940 im von den Nazis besetzten Paris geboren, und ihre sieben Jahre jüngere Schwester Silvia Gingold sind die Töchter der jüdischen, kommunistischen Widerstandskämpfer Ettie und Peter Gingold. Das Ehepaar floh vor den Hitlerfaschisten ins französische Exil. Nach dem Sieg über den Faschismus wurden sie in Frankreich für ihren Kampf in der Résistance ausgezeichnet. Sie zogen schließlich nach Westdeutschland.
Alice Czyborra engagiert sich gemeinsam mit ihrem Sohn gegen rechts, beispielsweise durch Besuche an Schulen oder Lesungen. Sie hat die Initiative »Kinder des Widerstands« mitbegründet, die sich der Zeitzeugenarbeit widmet. 2022 wurde ihr die Ehrenplakette der Stadt Essen verliehen. Diese soll ihr jahrzehntelanges Engagement unter anderem in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen (VVN-BdA) würdigen. Silvia Gingold war Sprecherin der VVN-BdA in Hessen und ist seit ihrer Jugend antifaschistisch engagiert. Sie kämpft als Betroffene gegen Berufsverbote und wehrt sich seit Jahren juristisch gegen die Beobachtung durch den Geheimdienst.
Wir erleben eine mit enormem Tempo forcierte Aufrüstung. Im Regierungslager wird eine Gefahr aus dem Osten heraufbeschworen, gegen die Deutschland und Europa sich verteidigen müssten. Wenn auch die politischen Vorzeichen heute andere sind, denken viele zurück an das letzte Mal, als Deutschland gegen Russland rüstete. Was ist von den Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der faschistischen Diktatur noch geblieben?
Alice Czyborra: Es ist unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit die »Kriegstüchtigkeit« des Boris Pistorius umgesetzt wird. Nur drei Beispiele der letzten Tage für die weitere Militarisierung unseres Landes NRW: die feierliche Einweihung des Rheinmetall-Werkes für Tarnkappenjets in Weeze, das erste öffentliche Gelöbnis vor dem Landtag in Düsseldorf und die Vorbereitung der gigantischen Rüstungsmesse 2026 in den Essener Messehallen. Dies alles, um den Feind Russland »abzuschrecken«. Die Aussage von Außenminister Wadephul »Russland wird immer ein Feind für uns bleiben« kann nicht eindeutiger die Russophobie dokumentieren. Sie überbietet noch Hass- und Hetzkampagnen gegen Russland unter der Adenauer-Regierung der 50er Jahre.
Wie schmerzhaft wäre es für unsere Eltern, dies heute zu erleben. Die Rote Armee hatte mit Stalingrad den Nimbus der Unbesiegbarkeit der deutschen Wehrmacht gebrochen. Sie war der Lichtblick und Hoffnungsträger für den Widerstand, für die vielen Menschen im Untergrund, für die Häftlinge in den Konzentrationslagern und Zuchthäusern. In seinen Erinnerungen hat unser Vater beschrieben, wie unser Großvater in seinem Versteck in einem Vorort von Paris BBC und Radio Moskau hörte und den Vormarsch der Roten Armee mit Stecknadeln auf der Landkarte markierte. Mit welcher Brutalität die deutsche Wehrmacht in der ehemaligen Sowjetunion wütete, verbrannte Erde hinterließ, den Tod von über 27 Millionen Sowjetbürgerinnen und -bürgern zu verantworten hatte, war im offiziellen Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung von Faschismus und Krieg kein Thema. Der Ausschluss der Vertreterinnen und Vertreter Russlands von den Gedenkfeiern zeugt von einer unglaublich beschämenden Geschichtsvergessenheit. Diejenigen, die an die größte Opferzahl der Roten Armee zur Befreiung von Faschismus und Krieg erinnerten, wurden dagegen diskriminiert und drangsaliert.
Ohne den Angriff Russlands gegen die Ukraine und die ständigen Bombardierungen rechtfertigen zu wollen, sehe ich mit Blick auf die unsägliche deutsche Geschichte die Bundesregierung in der Verantwortung, richtungsweisend für Europa alles zu tun, um den Krieg zu beenden, sämtliche diplomatischen Schritte zu unternehmen. Statt dessen liefert die Bundesregierung immer mehr Waffen in die Ukraine und trägt zur weiteren Eskalation bei. Sie schürt Ängste vor einer angeblichen Bedrohung durch Russland, ähnlich wie im Vorfeld beider Weltkriege des letzten Jahrhunderts. Dem zu widerstehen, brauchen wir eine starke Friedensbewegung, wie sie von den überlebenden Antifaschistinnen und Antifaschisten in der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre geprägt wurde.
Krieg und Imperialismus kehren an die »Heimatfront« zurück und wenden sich gegen die Bevölkerung: In europäischen Staaten werden Oppositionelle wegen des Protests gegen einen von israelischen Soldaten verübten Genozid in Gaza verfolgt. In den USA werden Menschen von staatlichen Agenten aufgegriffen und verschleppt. Sollte der Tag der Erinnerung und Mahnung im 80. Jahr seit 1945 nicht auch diesen Menschen gelten?
Czyborra: Wir Deutsche tragen eine besondere Verantwortung für die Existenz des Staates Israel, haben doch viele Jüdinnen und Juden durch Flucht nach Palästina ihr Leben retten können und im späteren Israel eine neue Heimat gefunden. Auch unsere Großeltern mütterlicherseits und weitere Familienangehörige sind als Überlebende des Holocaust nach Israel ausgewandert.
Die Bundesregierung spricht von »Staatsräson«, wenn Deutschland aufgrund seiner Geschichte, des Mordes an über sechs Millionen jüdischen Menschen, bedingungslos sowie ohne Wenn und Aber fest an der Seite Israels steht. Ist das nicht eine Instrumentalisierung des Holocaust? Verkehren wir nicht die Lehren aus unserer bitteren Geschichte ins Gegenteil, wenn jede Kritik am ungeheuerlichen Vorgehen der israelischen Regierung, des Militärs, wenn Proteste gegen die seit Jahrzehnten andauernde Besatzungspolitik und deren bedingungslose Unterstützung durch die Bundesregierung, wenn dies als »antisemitisch« kriminalisiert und zum Schweigen gebracht wird?
Unser Vater hat dazu geschrieben: »Gegenüber dem Verbrechen der Nazis haben viele geschwiegen. Wer aus Schuldgefühl heraus gegen Unterdrückung und Vertreibung der Palästinenser durch Israel schweigt, hat nichts gelernt. Verbrechen muss nicht erst das Ausmaß eines Völkermordes haben, damit Kritik berechtigt erscheint.« Ich finde es unerträglich, dass der Protest an Universitäten, auf Demonstrationen und Kundgebungen mit dem Etikett »Antisemitismus« behaftet wird. Mitgefühl und Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung und die Forderung, keine Waffen mehr nach Israel zu liefern, haben nichts mit Judenhass zu tun. Wir stehen an der Seite der Bewegungen in Israel, die für sofortigen Waffenstillstand, Beendigung des Krieges und die Rettung der noch lebenden Geiseln eintreten. Wir stehen an der Seite der Friedensbewegung Israels.
Wie verhält es sich mit dem wirklichen Judenhass?
Dem wachsenden Judenhass, dem Antisemitismus in unserem Land zu begegnen, liegt in unserer besonderen Verantwortung. Anschläge auf Synagogen, Schändungen von Gedenkstätten und Stolpersteinen, Verharmlosung des Holocaust oder gar Angriffe auf Jüdinnen und Juden erschüttern uns immer wieder. Es darf nicht zugelassen werden, dass in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden für die verbrecherische Politik der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden. Nicht wenige Menschen mit jüdischen Wurzeln demonstrieren Seite an Seite mit Palästinenserinnen und Palästinensern für Frieden in Gaza, für ein gleichberechtigtes und menschenwürdiges Leben des palästinensischen Volkes.
Die Organisationen, die derzeit zu Aktionen zum 80. Tag der Erinnerung und Mahnung aufrufen, wollen das Gedenken an die Opfer der Nazis mit »wichtigen Debatten der Gegenwart« verbinden. Welche Debatten sollten das aus Ihrer Sicht sein?
Gingold: Das wichtigste Anliegen am Tag der Erinnerung und Mahnung muss der Friedenskampf sein. Unter Mitwirkung von Antifaschisten findet sich im Artikel 69 der Hessischen Verfassung ein klares Friedensgebot: »Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet. Jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfassungswidrig.«
Die Widerstandskämpfer, die den faschistischen Terror, Konzentrationslager und Zuchthäuser überlebten, leisteten unschätzbar wertvolle Arbeit in ihrem unermüdlichen Ringen gegen das Vergessen. Unseren Eltern, die in unzähligen Schulen, Seminaren, Jugendorganisationen und Gewerkschaften von ihren Erlebnissen und Erfahrungen während des Faschismus berichteten und damit viele junge Menschen bewegten, war es wichtig, dass die nachfolgenden Generationen erkennen, wie unentbehrlich für die eigene Gegenwart und Zukunft die Erfahrungen der Überlebenden des antifaschistischen Widerstandes sind. Sie ermutigten viele junge Menschen, sich einzumischen gegen Naziideologie, Rassismus, Nationalismus und Militarismus.
»Niemand von uns, den Überlebenden«, so meinte unser Vater im Jahr 2005, »konnte sich vorstellen, dass es in diesem Land je wieder Aufrüstung, Militär, Militarismus, geschweige denn wieder deutsche Waffen und Soldaten in aller Welt geben könnte.« Unsere Eltern hätten es sich auch nicht vorstellen können, dass heute fast jeder zweite Euro in Militär und Rüstung fließt und in allen gesellschaftlichen Bereichen die Menschen auf Militarisierung und »Kriegstüchtigkeit« eingestimmt werden. Immer wieder appellierte unser Vater: »Ihr riskiert heute, wenn ihr euch gegen Rassismus und Ungerechtigkeiten wehrt, nicht das, was wir damals riskieren mussten. Aber macht das rechtzeitig, damit ihr nicht morgen das riskieren müsst, was wir damals zu riskieren hatten.«
Auf welche Erfahrungen und Spuren des Widerstandes gegen die Nazis können heutige Antifaschistinnen und Antifaschisten dabei noch Bezug nehmen?
Gingold: Die bitterste Erfahrung der Antifaschisten, die sie teuer bezahlen mussten, war die Uneinigkeit der Kriegs- und Hitlergegner. Erst im illegalen Widerstand, im Zuchthaus und KZ haben sich die Verfolgten verständigt und niemanden mehr gefragt, wer er sei, aus welcher Partei oder Organisation er komme. Aber es war zu spät. Die Folgen waren schrecklich. »Würden die Toten des Zweiten Weltkriegs auch nur einen Augenblick auferstehen können, es wäre ein einziger Aufschrei von Millionen: ›Wiederholt unsere Fehler nicht, macht es besser, steht zusammen. Erhaltet die Gemeinschaft eurer Friedensbewegung, damit ihr nicht wie wir zu einer Gemeinschaft von Toten werdet‹«, mahnte unsere Mutter auf der großen Friedenskundgebung im Bonner Hofgarten im Oktober 1983.
Immer wieder mahnten unsere Eltern, und sie würden es heute eindringlicher denn je tun: »Die Faschisten sind nicht an die Macht gekommen, weil sie stärker waren als ihre Gegner, sondern weil wir uns nicht rechtzeitig zusammengefunden haben. 1933 wäre verhindert worden, wenn alle Hitlergegner die Einheitsfront geschaffen hätten.« Für uns heute muss das bedeuten, Trennendes zu überwinden, um im Kampf um die Verteidigung des Asylrechts, gegen Rassismus und Gewalt, gegen die gigantische Aufrüstung und für soziale Gleichheit in breiten und machtvollen Bewegungen zusammenzufinden.
Am 9. September 1945 zogen Hunderttausende zur Werner-Seelenbinder-Kampfbahn in Berlin-Neukölln, um eine Massengedächtnisfeier für die »toten und lebenden Helden, die Kämpfer gegen den Faschismus« zu ehren, wie es auf einem Plakat von damals heißt. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN-BdA, sieht sich in dieser Tradition. Welche Entwicklung hat die Vereinigung aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahrzehnten vollzogen?
Gingold: Wichtig für die Entwicklung der VVN war die Öffnung für nachgeborene Generationen, um so die Tradition der antifaschistischen Erinnerung in die heutige Zeit zu überführen. Heute, da die Widerstandskämpfer und Gründer der VVN ihre Erfahrungen nicht mehr direkt weitergeben können, bedarf es großer Anstrengungen, den vielen neuen Mitgliedern, die in den letzten Jahren der VVN-BdA beigetreten sind, ein Verständnis für die historischen Traditionen dieser Organisation zu vermitteln. Dabei müssen wir auch auf ihre Vorstellungen von antifaschistischer Arbeit angemessen reagieren und neue Formen der Erinnerungsarbeit entwickeln, bei der junge Menschen aktiv mitwirken können. Ende März 2025 hatten wir in Kassel eine eindrucksvolle Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Ermordung italienischer Zwangsarbeiter in Kassel, bei der Schülerinnen und Schüler aus Frankfurt mit großer Emotionalität ihre Recherche zu den dort Ermordeten vortrugen. Dieses Beispiel zeigt: Gedenken ist auch für heutige Generationen möglich – genauso wie antifaschistisches Handeln gegen extreme Rechte und die AfD.
Auch wenn es derzeit innerhalb der VVN unterschiedliche Auffassungen über Analysen und Hintergründe der aktuellen Kriege gibt, ist es für mich unerlässlich, Trennendes zu überwinden. Im Sinne ihrer Gründer und des Schwurs von Buchenwald muss die VVN ein wichtiger Teil der Friedensbewegung bleiben.
Die junge Welt ist eine linke, marxistisch orientierte, überregionale Tageszeitung mit einem hohen Anteil an Hintergrundberichten, umfassenden Analysen und immer mittwochs mit der Antifaschismus-Themenseite. Die Printausgabe erscheint werktäglich mit mindestens 16 Seiten, sie ist im Abonnement und am Kiosk erhältlich.
Hier kommt ihr zum Probeabo.
Passend zum Thema des Interviews möchten wir eine Buchempfehlung abgeben:
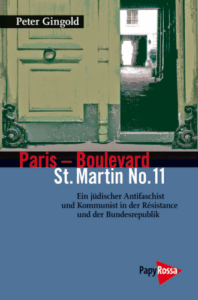 Gingold, Peter:
Gingold, Peter:
Paris – Boulevard St. Martin No. 11
Ein jüdischer Antifaschist und Kommunist in der Résistance und der Bundesrepublik
Hrsg. von Ulrich Schneider
Pappy Rossa, Neue Kleine Bibliothek 136, 187 Seiten, zahlr. Abbildungen
Peter Gingold (1916–2006) war einer der profiliertesten jüdischen Widerstandskämpfer und Kommunisten in der Bundesrepublik. Besonders seit den 70er Jahren trat er als Redner auf politischen Kundgebungen gegen Naziaufmärsche und als Zeitzeuge in Schulen und bei Jugendgruppen auf. Er hatte viel zu berichten: Die Zeit des aufkommenden Faschismus in Deutschland, Exil in Frankreich und Widerstand in den Reihen der Résistance (Illegalität, politische Agitation unter deutschen Besatzungssoldaten, Flucht aus den Fängen der Gestapo und Teilnahme am Aufstand zur Befreiung von Paris 1944). Den 8. Mai 1945, das »Morgenrot der Menschheitsgeschichte«, erlebte er in Turin mit der italienischen Resistenza. Zurückgekehrt nach Deutschland, gestaltete er dort den politischen Neuanfang aktiv mit, musste jedoch erleben, wie er und seine Familie danach fast zwei Jahrzehnte der erneuten Verfolgung, der Ausbürgerung und des Berufsverbots erlebten. Trotzdem verstand er sich stets als »Mut-Macher«, seine Maxime: »Nie aufgeben!«
Eine ausführliche Rezension des Buches von Horst Gobrecht findet ihr hier angehängt; alternativ oder ergänzend findet ihr hier ein Interview vom Radio Dreyeckland mit Ulrich Schneider, Autor zahlreicher Beiträge zum Thema Widerstand und Herausgeber des Buches.
„Werde ich sie packen können?“
Horst Gobrecht bespricht das Buch von Peter Gingold: „Paris – Boulevard St. Martin No. 11“
„Es ist nicht wirkungsvoll, die Weltgeschichte zu schildern, ohne ihr die Färbung der eigenen Gefühle zu verleihen.“ Diese „Nachgedanken“ von Sonja Axen sind auf den Kommunisten und Antifaschisten Peter Gingold gemünzt. Wer ihn kannte, der findet ihn in diesem Buch live wieder – ohne künstliche Schnörkel und sprachliche Raffinessen. „Er konnte mit seinem rhetorischen Talent besonders junge Menschen ansprechen und begeistern“, vermerkt der Herausgeber Dr. Ulrich Schneider über den Autor, der „keine akademische Sprache“ und diese „unabhängig von den Regeln der deutschen Syntax“ verwendete.
Vielleicht lag darin die Begeisterung beim Zuhören. Schon wer Peter Gingold im Dialog erlebte, der sah bei ihm in Augen, „deren Blick man sucht und wieder sucht, von denen angesehen zu werden man als Erfrischung, als Belebung empfindet“ , weil sie trotz seines hohen Alters jugendlichen Eifer und Flexibilität im Denken ausstrahlten. Der Funke sprang über, wenn er als Zeitzeuge des antifaschistischen Widerstands mit und vor Menschen sprach, die von ihm letztlich wissen wollten: „Was kann jeder einzelne tun?“ Bei der nicht selten schwierigen Antwort darauf gab er keine allgemeingültigen Belehrungen, sondern stellte sein Engagement „für die Jugend möglichst detailliert“ dar; denn das „ist für Jugendliche das Faszinierendste, das Spannendste“. Viele seiner Gesprächspartner und Zuhörer waren nämlich politisch eher indifferent, weshalb er sich immer wieder prüfend und selbstkritisch die entscheidende Frage stellte: „Werde ich sie packen können?“
Die von Peter Gingold angesprochenen „Details“ haben ihre gesellschaftlichen und politischen Wurzeln in einer Zeit, die für die meisten heute Lebenden weit entrückt ist, über die der konventionelle Schulunterricht und die bürgerlichen Medien meist nur Oberflächliches, wenig Hintergründiges, aber viel Tendenziöses bereit halten. Der Autor beschreibt in seinem Buch, wie er, 1916 geboren und mit fünf Geschwistern „in den ärmlichen Verhältnissen, in den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren“ aufgewachsen, bei „allen Entbehrungen“ und „aller Knappheit“ doch „eine glückliche Kindheit“ erlebte, in der er „keinen Hunger“ kannte. Für viele Menschen von heute ist vielleicht eher rätselhaft, wie seine Mutter unter solchen Bedingungen trotzdem „lebenslustig, voller Optimismus“ bleiben konnte, sie „ihre Lippen regelmäßig geschminkt“ hat und nach dem Essen eine Zigarette rauchte, die „für sie ein Zeichen der Unabhängigkeit“ war.
„Etwas davon habe ich von ihr geerbt“, meint Peter Gingold und alle, die ihn auf der Konferenz zu seinem 90. Geburtstag im Frühjahr 2006 hörten, spürten diese „Erbschaft“ in seiner von Lebensfreude, Leidenschaft und Kraft geprägten Rede, obwohl ihn bereits unerträgliche physische Schmerzen peinigten. Es sind nicht die großen theoretischen Abhandlungen – er sei „kein Wissenschaftler, kein Historiker“, gesteht er freimütig -, sondern das persönlich Erlebte und Gefühlte, die seine Authentizität begründen und immer wieder hervortreten lassen. Sein Denken und Handeln sind nicht nur politisch motiviert, sondern zutiefst von menschlichen Empfindungen geprägt; beispielsweise ignoriert er in der Illegalität des von den deutschen Faschisten besetzen Frankreich „alle Regeln der Konspiration“, um „zwei, drei Tage im Kreis meiner Familie“ verbringen zu können.
Seine Retrospektive auf die politische Sozialisation in Jugendjahren ist alles andere als besserwisserisch: „auch ich hätte ein begeisterter Anhänger der Hitlerjugend sein können, wenn ich anderer Abstammung gewesen, aus einem anderen Milieu gekommen, anders beeinflusst worden wäre“. Peter Gingold lässt der Leserin und dem Leser die Chance, über den eigenen Lebensentwurf in Ruhe nachzudenken, will sie „gefühlsmäßig erreichen“ und ihnen „gleichzeitig Denkanstöße geben“, so wie er es bei einer Rundreise 2005 mit der IG BAU in Nordrhein-Westfalen tat, um sich etwa zweitausend Berufsschülern zu nähern. Doch bei allem Verständnis für Schwächen und Fehler der Handelnden und Zögerlichen „damals“ ist die Botschaft für die Jugendlichen der Gegenwart nicht nur unzweideutig, sondern auch provozierend, weil sie keinen Fluchtweg offenhält: „Sie hatten keine Erfahrung, was Faschismus bedeutet, wenn er einmal an der Macht ist. Aber heute haben wir alle diese Erfahrung, heute muss jeder wissen, was Faschismus bedeutet. Für alle zukünftigen Generationen gibt es keine Entschuldigung mehr, wenn sie den Faschismus nicht verhindern.“
Mit dieser Herausforderung für Gegenwart und Zukunft ist für Peter Gingold die bedrückende, aber wichtige mahnende Erkenntnis unmittelbar verknüpft: „1933 wäre verhindert worden, wenn alle Hitlergegner die Einheitsfront geschaffen hätten.“ Sie wurde für ihn leitendes Motiv für sein politisches Handeln. Seine fragmentarische, über weite Strecken eher skizzenhafte autobiographische Schrift widerspiegelt diesen aus den realen Verhältnissen und seinen eigenen Erfahrungen entstehenden und sich entwickelnden Prozess des persönlichen Bewusstwerdens, nicht bloß, dass es galt, sondern auch wie es möglich und nötig war, sich „einzumischen, nicht alles hinzunehmen, was auf mich einstürzte, was sich um mich herum tat“. Dies beginnt für ihn im Alter von fünfzehn, sechzehn Jahren, also 1931/32. Jedoch hatte er zu dieser Zeit bereits erlebt, wo er von der Weimarer Gesellschaft „hingestellt“ worden war.
Die ersten Jugendjahre verbrachte er mit seinen vor dem Ersten Weltkrieg aus Polen nach Deutschland eingewanderten Eltern in Aschaffenburg. Die Gingolds waren eine sicher religiöse, aber gleichzeitig weltoffene jüdische Familie: „Meine Mutter nahm die jüdischen Gesetze ziemlich genau, mein Vater weniger.“ Beide sprechen „nicht richtig Deutsch“, sondern „fast nur Jiddisch“. Damals hat Peter Gingold sich deswegen „ihrer geschämt“, doch später schätzt er „Jiddisch als die schönste, ausdruckstärkste, kaum übersetzbare Sprache“. Er besucht in Aschaffenburg regelmäßig die Synagoge und war aus seiner Sicht „sehr gläubig“. Von Antisemitismus spürt der Junge in seiner Kinderclique nichts. Nur eine Episode bleibt ihm in Erinnerung: Als die Familie seine Bar-Mizwa zuhause feiert, ärgert der antisemitische Hausmeister die Gäste, indem er das Geländer im Gebäude mit Senf beschmiert, was die geladenen Gäste, „darunter feine Damen mit weißen Handschuhen“, entsetzt.
1929 ziehen die Gingolds nach Frankfurt, wo der Sohn Peter 1930 eine Lehrstelle sucht, aber durch die grassierende Erwerbslosigkeit keinen gewünschten Ausbildungsplatz als Buchdrucker oder Schriftsetzer findet: „Also wurde ich Lehrling in einer kleinen Musikgroßhandlung“, in der er in drei Jahren „so gut wie nichts“ lernt. Die Familie darbt wie Millionen anderer Menschen; sein Vater erhält als Schneidermeister kaum Aufträge, und seine Mutter versucht, als Hausiererin „etwas dazu zu verdienen“. Da sind die dreißig Mark Monatslohn des Lehrlings Peter Gingold eine wichtige, wenn auch „eine winzige Unterstützung“ für die große Familie. Mit vierzehn – „politisch völlig unbeleckt“ – beobachtet er spontane Demonstrationen von Arbeitslosen, die „Wir haben Hunger, wir wollen Arbeit und Brot!“ rufen. Die Notlage und den Aufschrei dieser Menschen konnte der Jugendliche sicher nachempfinden. Solche Aktionen nutzt die Staatsmacht, um häufig erbarmungslos einzugreifen: „Das Überfallkommando der Polizei in blauen Uniformen und dem bekannten Helm, dem Tschako, auch auf Pferden, knüppelte oft in die Menge hinein. Es hat mich enorm schockiert.“
Dem folgt fast zur gleichen Zeit folgt „ein anderer Schock“, als Peter Gingold „braune Kolonnen, Hakenkreuze am Arm, marschieren sah und ihr Gebrüll hörte: ,Deutschland erwache, Juda verrecke, Rot-Front verrecke'“. Diese Aufmärsche der Nazis enden nicht selten in Straßenschlachten, bei denen meistens „die ,Braunen‘ in die Flucht geschlagen“ werden. Solche Erlebnisse beginnen den interessierten, aber eher noch unbeteiligten Jugendlichen „aufzuwühlen“. In dieser Situation trifft er auf Gleichaltrige, die ihn in die Gewerkschaftsjugendgruppe aufnehmen möchten. Peter Gingold vermerkt: „Ich wusste nicht, was eine Gewerkschaft ist.“ Er wollte also von deren Sinn und dem notwendigen Engagement in und mit ihr überzeugt werden. Doch so richtig scheinen die politischen Argumente nicht gegriffen zu haben. Bei ihm funkt es erst, als die jungen Kollegen schildern, „was sie alles in der Gruppe machten. Als sie mir sagten: ,Wir sind Jungen und Mädchen‘ – aha Mädchen! -, da war ich entschlossen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden.“
Die „neue Welt“ der Gewerkschaft hält für Peter Gingold reichlich sozialpolitische Literatur bereit, die er buchstäblich verschlingt. Sie bringt ihm auch andere linke Publikationen nahe und lässt ihn „eines Tages sogar das Kommunistische Manifest“ lesen. In einem Zeltlager der Gewerkschaftsjugend lernt er eine Gruppe junger Kommunisten kennen und wird nach langer Debatte „überzeugt, Jungkommunist zu werden“. Im Kommunistischen Jugendverband der KPD wird ihm schnell die Verantwortung als Obmann für den Literaturvertrieb übertragen. Er beteiligt sich fortan selbst an Straßenschlachten mit jungen Nazis, nimmt aber auch die Gelegenheit wahr, „mit einzelnen Mitgliedern der Hitlerjugend zu diskutieren“ oder sich in ein Streitgespräch von zwanzig Jungkommunisten mit dreißig Nazijugendlichen im HJ-Lokal hineinzuwagen. Der HJ bringt das argumentative Duell zwar „ein niederschmetterndes Ergebnis“, aber die jungen Gegner trennen sich dennoch friedlich. Das geschah Anfang 1932, kein Jahr später wurden neue politische und gesellschaftliche Verhältnisse etabliert.
Die Ursachen für diese Wende liegen nicht nur im Willen der Herrschenden, die Nazis an die Regierung zu hieven, sondern auch in der für Peter Gingold „bitterste[n] Erfahrung“: „Die Faschisten sind nicht an die Macht gekommen, weil sie stärker waren als ihre Gegner, sondern weil wir uns nicht rechtzeitig zusammengefunden haben.“ Am Anfang seines jetzt beginnenden illegalen Engagements gegen die Nazis und Hitlerdeutschland steht eine mutige Tat, eine beherzte Geste der Ablehnung und des Protests: Nach dem von den Faschisten inszenierten Reichstagsbrand bildet sich am 28. Februar 1933 in der Frankfurter Innenstadt vor dem offiziellen Mitteilungskasten eine Menschentraube und liest auf einem Aushang, Kommunisten hätten den Reichstag angezündet, das sei ein Fanal des kommunistischen Aufstands. Und ein SA-Mann beklebt diesen Zettel mit einem Hakenkreuz. Der knapp 17-jährige Peter Gingold reagiert prompt und ebenso demonstrativ: „Ich öffnete den Kasten für Plakatanschläge und entfernte im Beisein der Menge das Hakenkreuz. Das war sozusagen meine erste Tat des ,Widerstands'“ – und er entzog sich anschließend dem Zugriff der SA.
Sein weiterer Weg führt ihn wie viele Antifaschisten in den Untergrund, während seine Eltern und Geschwister im Sommer 1933 nach Paris emigrieren. Peter Gingold bleibt in Deutschland, wird aber verhaftet, wochenlang eingesperrt und dann des Landes verwiesen. Im gleichen Jahr überquert er illegal die französische Grenze. Die Umstände seiner Ausreise mögen dramatisch sein, für ihn ist die Situation aber „auch spannend, ja sogar ein Abenteuer, Frankreich, Paris und den Eiffelturm zu sehen“. Er kommt bei seinen Eltern unter, deren Asyl allerdings auf tönernen Füßen steht; denn sie besitzen noch immer die polnische Staatsangehörigkeit und müssen sich eine Verlängerung des Aufenthalts in Frankreich immer wieder polizeilich genehmigen lassen. Erst die veränderten Bedingungen unter der linken Volksfront-Regierung sorgen 1935 für eine endgültige Aufenthaltserlaubnis. Der Vater findet als Schneider in Frankreich „immer Arbeit“, und seine Mutter eröffnet ein Restaurant, das fortan auch zum Treffpunkt linker Emigranten wird.
Peter Gingold arbeitet als Laufbursche beim „Pariser Tagblatt“ und organisiert sich mit anderen aus Deutschland geflüchteten Jungkommunisten, die als „politisch gefestigte Gruppe gleich zu Beginn der Besetzung Frankreichs zu den ersten Mitgliedern der Résistance zählte“. Hier lernt er seine spätere Frau Ettie, „ein zartes, junges, hübsches Mädchen“ aus der rumänischen Provinz Bukowina, kennen. Sie lebt in Paris bei ihrer Tante und ihrem Onkel, „beide überzeugte Kommunisten“. Mit ihr gemeinsam unterstützt er den „schweren Kampf gegen das jugendfeindlichste aller Systeme“, den Faschismus. Beide wollen wie viele ihrer Gruppe am spanischen Befreiungskampf gegen die Franco-Invasoren teilnehmen, müssen diese Pläne aber aufgeben, weil sie im französischen Widerstand gebraucht werden. Sie helfen den in Spanien kämpfenden Antifaschisten mit der Sammlung von Geld, Arzneimitteln und medizinischen Instrumenten.
Ettie und Peter Gingold heiraten Anfang 1940, im Sommer wird ihre erste Tochter Alice geboren. Doch wie viele Deutsche wird Peter Gingold nach dem Überfall der faschistischen Wehrmacht auf Frankreich interniert, verpflichtet sich dort als paramilitärischer französischer „Arbeitssoldat“ und sieht Ettie und das Neugeborene erst nach seiner Demobilisierung im September 1940 wieder. Das Paar beginnt den Widerstand gegen die Besatzer mit der „Aufklärung der deutschen Bevölkerung“ durch kleine Flugschriften, die Peter Gingold als „symbolische Handlung“ einstuft, weil sie den Franzosen „zeigen sollten, es gibt auch andere Deutsche, nicht jeder ist ein Nazi“. Später arbeiten beide für den Bereich TA – „travail allemand“ = „deutsche Arbeit“ – der KPF, wobei Peter Gingold auch mit französischen Partisanen kooperiert, und für das 1943 gegründete „Komitee Freies Deutschland für den Westen“.
Das für ihn wohl erschütterndste Erlebnis dieser Jahre: Sein Bruder Leo wird im Juli 1942 in seinem illegalen Zimmer in Paris „als Peter Gingold verhaftet“. Dieser hatte ihn bei den beginnenden Deportationen der Juden schützen wollen und ihm seine illegale Identitätskarte gegeben, weil in ihr „kein J eingestempelt war und mit der er sich ungehindert bewegen konnte“. Die Spur von Leo Gingold verliert sich nach dem letzten Aufenthalt im Sammellager Drancy bei Paris, von wo aus er möglicherweise in ein Vernichtungslager transportiert wurde. Seinem Bruder Peter bleibt fortan die bedrückende, ja quälende Erkenntnis: „Er hat mir mein Leben gerettet, mich vor Auschwitz bewahrt, während er durch mich nach Auschwitz kam und ein entsetzliches Ende gefunden hat.“ Seine Eltern, Ettie und Alice überlebten die systematische Suche nach Juden in einer sicheren Unterkunft auf dem Land.
Dem von den deutschen Faschisten programmierten Tod entrinnt Peter Gingold nach seiner Verhaftung und grausamer Folter durch eine kühne Flucht am 23. April 1943. Er lockt vier mit Pistolen bewaffnete Gestaposchergen zu einem angeblichen Treffpunkt mit einer Kontaktperson der Résistance vor das Haus Boulevard St. Martin No. 11 in Paris – und verschwindet durch einen gewagten Sprung hinter der offenen Tür auf Nimmerwiedersehen. Denn als „Alteingesessener“ kennt er die Örtlichkeiten besser als die fremden Besatzer. Die Passanten beobachten das von den Nazis anschließend veranstaltete Spektakel und stellen frohlockend fest: „Sie haben ihn nicht erwischt!“
Die im Buch geschilderte Arbeit von Ettie und Peter Gingold sowie anderen deutschen Antifaschisten in der französischen Résistance lässt sich nicht in einer Rezension nacherzählen, nicht einmal gründlich zusammenfassen. Hier sollen deshalb die groben Umrisse des Engagements genügen. Wer tiefer einsteigen will und das Wechselbad an Erlebnissen und Gefühlen, das manchmal Auf und Ab im antifaschistischen Widerstand der beiden kennenlernen möchte, der wird in Peter Gingolds autobiografischer Schrift reichlich Interessantes, aber auch Anknüpfungspunkte zum Nachdenken und Weiterforschen finden. Denn wie sein Einstieg in die Politik, so bewegend liest sich auch sein weiterer Kampf für die Befreiung von Faschismus und Krieg, gegen die politische Restauration und Remilitarisierung der Bundesrepublik, gegen das Berufsverbot für seine zweite Tochter Silvia, für eine starke VVN-BdA, gegen eine politische Abwicklung der IG Farben. „Seine Erinnerungen sind ein Beitrag gegen das Vergessen und bleiben Mutmacher in den vor uns liegenden Kämpfen um eine bessere Welt“, so resümiert Sonja Axen, und sie komprimiert den historischen wie aktuellen und bleibenden Wert der Schrift damit in einem Satz.


